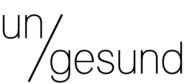Psychologische Online-Selbsttests als neoliberales Mittel der Selbsterforschung
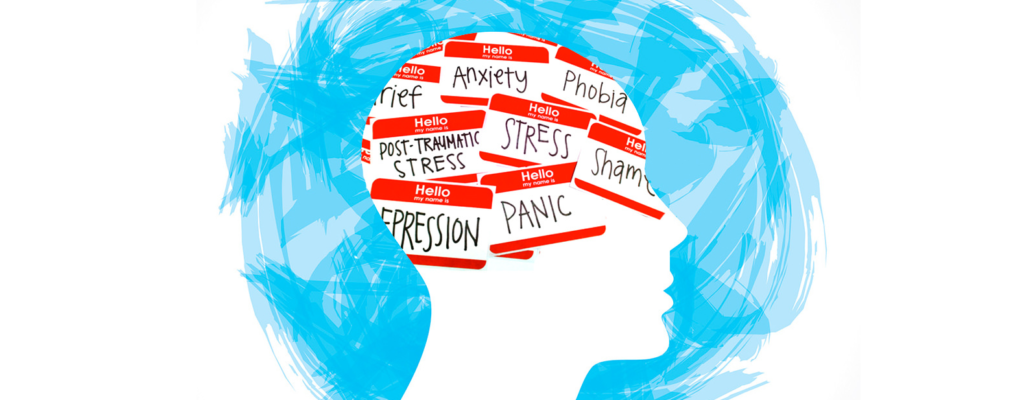
[su_accordion][su_spoiler title=“Forschungsfrage“ open=“yes“ style=“default“ icon=“plus“ anchor=““ class=““]Inwiefern beeinflussen digitale Techniken der Selbsterforschung, wie die Nutzung von psychologischen Online-Selbsttest, das Bild der eigenen mentalen Gesundheit?[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Keywords“ open=“no“ style=“default“ icon=“plus“ anchor=““ class=““]mentale Gesundheit, Selbsterforschung, Online-Selbsthilfe, Selbsttest, neurotisches Subjekt, Selbstmanagement, Selbstoptimierung, Neoliberalismus[/su_spoiler][su_spoiler title=“Verfasserin“ open=“no“ style=“default“ icon=“plus“ anchor=““ class=““]Laura Arndt (01.03.2019)
Universität Hamburg – Volkskunde/Kulturanthropologie im Bachelor[/su_spoiler][/su_accordion]
[su_divider top=“no“ style=“dotted“ divider_color=“#656565″ size=“2″ margin=“30″]
Mentale Gesundheit
Zwischen medizinischem Diskurs und Populärwissenschaft
[su_quote cite=“Elisabeth Mixa 2016: S. 9.“]Einem relativen Wohlstand westlicher Gesellschaften […] stehen neue Befindlichkeitsstörungen und eine Ausweitung psychiatrischer bzw. zumindest therapeutisch als behandlungsbedürftig erachteter Zustände einer stetig wachsenden Gruppe von Leidenden gegenüber.[/su_quote]

© UHH/Arndt
Das Thema mentale Gesundheit mit seinen medialen Lieblingen Depression, Angststörung und Burnout1 hat mittlerweile längst Einzug in viele Bereiche des gesellschaftlichen und privaten Lebens erhalten. Ob Unternehmen, Beziehungen, Erziehung, Medien oder persönliche Entwicklung – kaum ein Bereich ist nicht von dem psychologischen Diskurs durchzogen.2 Interessant scheint dabei der paradoxe Umstand zu sein, dass trotz steigendem Wohlstand und vielfältigeren Selbstverwirklichungsmöglichkeiten immer mehr Menschen die Diagnose ‚psychisch krank‘ erhalten, und (oftmals lapidar) geäußerte Selbstdiagnosen auf Basis von breit gestreutem Populärwissen über Symptome zunehmen.3 Ob es sich dabei wirklich um eine Zunahme des Risikos psychischer Erkrankungen handelt, oder nur um einen veränderten Umgang mit den behandlungsbedürftig erachteten Zuständen seitens Patient*innen und Ärzt*innen, wird viel diskutiert.4 Ich möchte mir hier nicht anmaßen diese Frage abschließend klären zu können und beabsichtige auch nicht, in diesen Diskurs mit einzusteigen. Stattdessen möchte ich mir eben jene Personen genauer anschauen, die (noch) nicht den klassischen Weg über Therapeut*innen und Ärzt*innen gehen, um sich mit ihren an sich wahrgenommenen Symptomatiken auseinanderzusetzen.
[su_spacer size=“30″]
Psychotherapeutische Versorgung als überregionales Problem
Denn wer schon einmal einen Termin für eine Psychotherapie machen wollte, weiß, dass die Wartezeit oftmals mehrere Monate betragen kann. Laut der Bundespsychotherapeutenkammer liegt die akzeptable Wartezeit auf ein Therapeutenerstgespräch bei drei Wochen, um eine Verschlimmerung oder Chronifizierung des Zustands nicht zu riskieren. Doch selbst in den Großstädten Deutschlands mit einer beispiellos hohen Therapeutendichte wie Hamburg, beträgt die Wartezeit im Schnitt über zwei Monate. Ein möglicher Therapiebeginn und somit auch der Diagnosestellungsprozess beginnen zumeist erst nach weiteren drei Monaten.5

Grafik: © UHH/Arndt
Ein Weg also, der für viele, die nicht bereits von dem Stigma psychischer Erkrankungen abgeschreckt sind,6 wenig attraktiv ist – insbesondere, wenn man sich nun einmal noch gar nicht so sicher ist, ob eine Therapie wirklich angebracht ist. Abhilfe versprechen in diesem Fall Online-Selbsthilfeprogramme mit psychologischen Selbsttests: In Form von Webseiten und Apps wollen sie Auskunft über das mögliche Vorhandensein und die Schwere der vermuteten psychischen Krankheit geben und Programme zu dessen selbstständigen Behandlung bereitstellen.
[su_divider top=“no“ style=“dotted“ size=“1″ margin=“30″]
Vorgehensweise
Um die zugrundeliegenden Annahmen über mentale (Un)Gesundheit herauszustellen und zu ergründen, wie die Nutzung der psychologischen Selbsttests das Bild der mentalen Gesundheit beeinflussen kann, möchte ich versuchen, mich von unterschiedlichen sozial- und kulturwissenschaftlichen Perspektiven dem Thema analytisch zu nähern. Dafür nehme ich die Aspekte der Selbstthematisierung und Selbsterforschung, welche einem solchen Selbsttest innewohnen, als Ausgangspunkte meiner Analyse. Besonders möchte ich die Auswirkungen auf das Selbstbild und die dahinterliegenden, impliziten Imperative der Selbstoptimierung und des ‚Wohlfühlens‘ herausstellen.
Die geschichtlichen und kulturellen Dimensionen psychischer Krankheiten seit dem Aufkommen des psychiatrischen Diskurses mit Sigmund Freud und die Konstruktion der Kategorien und Diagnosen im Bereich mentaler Gesundheit bilden hierbei den historischen und gesellschaftlichen Rahmen. Mit Bezug auf die zunehmende Subjektivierung von Gesundheit möchte ich innerhalb dessen anhand des Konzepts des ‚Neurotic Citzen‘ von Monica Greco7 den Zusammenhang zwischen neoliberalen Strukturen, Selbstverantwortung und affektiven Ängsten ergründen und als Basis meiner Analyse des vorliegenden Interviews mit einer Nutzerin eines Online-Burnout-Selbsttests nutzen.8
[su_spacer size=“30″]
Forschungsdesign
Das Feld der Medizinanthropologie bietet überaus abwechslungsreiche Forschungsbereiche, kann einen aber aufgrund der Sensibilität des Themas vor Herausforderungen beim Zugang zum Feld stellen.9 Der Bereich ‚mentale Gesundheit‘ bildet hier keine Ausnahme. Eher noch ist das gesellschaftliche Stigma psychischer Erkrankungen ein zusätzlich erschwerender Faktor. Die Dezentralisierung, Überregionalität und Anonymität – normalerweise Vorteile digitaler Angebote – führen darüber hinaus dazu, dass Nutzer*innen im Online-Bereich nicht gezielt angesprochen werden können. Glücklicherweise gelang es mir trotzdem Susanne, Nutzerin eines Online-Burnout-Selbsttests, für ein narratives Interview zu gewinnen. Diese Form der empirischen Forschung erlaubt es den Interviewten, Themen in ihren eigenen Relevanzsystemen darzustellen und somit deren Selbstwahrnehmung, intrinsische und extrinsische Motivationen und Bedeutungsmuster mit einzubeziehen.
Die autoethnographische Nutzung von verschiedenen Selbsttests, Analysen von Rezensionen, Bewertungen und Testberichten10 und eine wegen Intransparenz und der großen Anzahl an Anbietern und Akteuren nicht ausgereizte Ethnographie der Infrastruktur11 waren für weitere Einblicke Teil dieses Forschungsdesigns, werden hier jedoch nicht explizit angesprochen. Aufgrund eines Mangels an kulturanthropologischer Forschung zu diesem Thema werde ich zudem versuchen, mich durch die Analyse des interdisziplinären, wissenschaftlichen Diskurses dem Forschungsgegenstand zu nähern und verschiedene Teilaspekte dieses recht neuen Phänomens miteinander verbinden, um eine theoretische Analyse zu ermöglichen.
[su_divider top=“no“ style=“dotted“ size=“1″ margin=“30″]
Das sagt die Wissenschaft
Klinische Forschungen im Bereich Medizin und Psychiatrie
Derzeit gibt es eine Vielzahl an klinischen Studien, welche die ‚Wirksamkeit‘ und ‚Effizienz‘ von Online-Selbsthilfe-Programmen und psychologischen Screening-Tests erforschen.12 13 14 Die Studien bestätigen deren Wirksamkeit zwar fast durch die Bank weg, bedienen sich hierfür aber auch immer klassischer, psychiatrischer Kategorien und Verfahren.15 Dafür beziehen sie die Bedeutungssysteme, Nutzungsmotivationen und das Selbstbild der Nutzer*innen nur bedingt bis gar nicht mit ein. Der evidenzbasierte Ansatz dieser Verfahren mit seinem Anspruch der Vergleichbarkeit führt dabei, wie Stefan Ecks es beschreibt, zu einer Reproduktion eben dieser klaren, medizinischen Kategorien.16 Die kritische Perspektive der Medizinanthropologie, für die Ecks in seinem Artikel plädiert, wird in der Forschung zu diesem Thema nahezu vollständig vernachlässigt. Stattdessen befassen sich mehrere Theorien aus den Sozial- und Kulturwissenschaften mit Teilaspekten des untersuchten Phänomens, die ich im Folgenden vorstellen möchte, beginnend mit dem Aspekt der Selbsterforschung.
[su_spacer size=“30″]
Selbsterforschung
[su_custom_gallery source=“media: 5542,1929,1927″ limit=“5″ link=“lightbox“ width=“240″ height=“400″]
Sich selbst erforschen zu wollen – wie dies bei den Selbsttests unterstellt werden kann,17 ist dabei nicht erst ein Konzept der Neuzeit. Stefan Selke erklärt in seinem Buch ‚Lifelogging‘, dass es „schon lange vor dem Aufkommen digitaler Technologien […] Visionen zur Totalerfassung des eigenen Lebens“18 gab. Mit der zunehmenden Technisierung in Form von Smartphones, Wearables und intelligenten Algorithmen lässt sich ein großer Teil des täglichen Lebens vermessen und kleinteilig analysieren.19 Bisher hat sich dieser Trend jedoch größtenteils auf körperliche Daten beschränkt. Das Versprechen objektiver Daten und Auswertungen auf individueller Basis lockt dabei, und fußt laut Selke auf der Philosophie Gustav Großmanns20, dem Begründer des modernen Selbstmanagements. Seine Methode verlangt vom Einzelnen, Mängel zu identifizieren und durch rationales Handeln zu beheben. Somit wurde eine Verhaltenslehre geschaffen, die alle Bereiche des Lebens zum „Objekt der Sorge“ mit implizitem Selbstoptimierungsauftrag mache.21 Doch je mehr erfasst und ausgewertet werden könne, desto wahrscheinlicher sei das Auftreten von abnormen Ergebnissen.22 Zudem könne das Erfassen oder die Auswertung von ’schlechten‘ Daten das Selbstbild zusätzlich negativ beeinflussen. So schreibt er:
[su_quote cite=“Stefan Selke 2016: S. 105″]Es steht jedenfalls zu befürchten, dass Selbstvermessung und kollaboratives Heilen auch Gefahren bergen und krankhafte Züge annehmen können. Die Messwerte selbst könnten sich negativ auf den Gesundheitszustand auswirken. Werden ’schlechte‘ Körperdaten gemessen, kann der paradoxe Effekt entstehen, dass sich die vermessende Person ’schlecht‘ fühlt, obwohl sie eigentlich gesund ist.[/su_quote]
[su_spacer size=“30″]
Selbstoptimierung
Wie viele Bereiche des Lebens bereits dem Selbstoptimierungsgedanken anheimfallen, wird bei einem Blick auf den stetig wachsenden Fundus an Ratgebermedien23 klar. Die individuellen Heilsversprechen schlagen dabei in dieselbe Kerbe wie die Selbstvermessungsprogramme: Die beste Version seiner selbst zu werden und negative Gefühle zu vermeiden. Dafür sollen Defizite identifiziert und mittels rationaler, angeleiteter Handlungen in Kompetenzen verwandelt werden24 – wie auch bei einem Blick auf die Apps im Bereich ‚mentale Gesundheit‘ deutlich wird.25
[su_custom_gallery source=“media: 5540,5541,1928″ limit=“5″ link=“lightbox“ width=“240″ height=“400″]
Das somit idealisierte Selbst auf das hingearbeitet wird, ist der Maßstab, an dem sich das Subjekt zu messen hat. Erfüllt es diese horrenden Ansprüche nicht, so werde dieses ‚Scheitern‘ nur allzu oft mit eben jenen negativen Gefühlen bestraft, die es zu vermeiden galt.26 Nadine Teuber geht in ihrer historischen Analyse der Depression sogar noch einen Schritt weiter. Sie sieht in den ökonomisierten Coaching- und Wellness-Angeboten nicht nur eine Quelle von Unwohlgefühlen, sondern sogar eine Pathologisierung von sämtlichen Abweichungen vom darin portraitierten Ideal.27
[su_spacer size=“30″]
Selbstthematisierung
[perfectpullquote size=“15″ align =“right“ cite=“M. Schroer 2006: S. 41″]“Ohne ein Mindestmaß an Selbstreflexion, an einer Auseinandersetzung mit dem eigenen Werden und Gewordensein kommt heute niemand mehr durchs Leben, selbst wenn er es wollte.“[/perfectpullquote]
Der Wunsch, sich selbst zum Gegenstand der Analyse zu machen, ist dabei nicht nur nichts Neues, er hat auch im letzten Jahrhundert Konjunktur gemacht und wurde veralltäglicht.28 Doch nicht nur die eigene Sicht, sondern auch die anderer auf einen selbst ist dabei entscheidend. Das durch die Selbstreflexion thematisierbare Selbst wird an diese kommuniziert und durch deren Rückspiegelung gleichsam mitkonstruiert und im Idealfall bestätigt.29 Den Höhepunkt dieser Selbstthematisierung finden wir in der Psychoanalyse. Insbesondere seit Sigmund Freud stehen uns eine Vielzahl an sprachlichen Kodes zur Verfügung, um das in den Mittelpunkt gerückte Selbst auszudrücken. Der therapeutische Diskurs mit seiner Sprache durchdringe jedoch nicht nur alle gesellschaftlichen Bereiche wie bspw. Beziehungen, Arbeit, Erziehung und Massenmedien. Er sei strukturell sogar so angelegt, dass er unter Umständen endlos Bedürfnisse formuliere und hervorbringe, wie es die Soziologin Eva Illouz darstellt.30
Die Sprache konstruiert dabei aber nicht nur das Selbst mit, es konstruiert ebenso unser Wissen um Krankheit und Gesundheit – besonders wahr ist das wohl im Bereich der größtenteils nur subjektiv ausdrückbaren psychischen Erkrankungen.
[su_quote cite=“Eva Illouz 2009: S. 24″]Die Sprache definiert Gefühlskategorien, legt fest, was als ‚emotionales Problem‘ gilt, stellt die kausalen Bezugsrahmen und Metaphern zur Verfügung um diese Probleme zu verstehen, und beschränkt die Möglichkeiten, wie Gefühle ausgedrückt, verstanden und gehandhabt werden können.[/su_quote]
[su_spacer size=“30″]
Gesellschaftliche und historische Konstruktion psychischer Krankheiten
„Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit und Gebrechen“. So lautet die viel zitierte aber auch kritisierte Definition von der World Health Organisation Charta aus dem Jahre 1946. Auch hier findet sich ein idealisierter Wunschzustand basierend auf subjektiv Wahrgenommenem und Erwartetem wieder. Es verwundert also nicht, dass Kultur- und Sozialwissenschaftler wie Nikolas Rose31 oder Alain Ehrenberg32 immer wieder zu dem Schluss kommen, dass psychische Krankheiten durch historische und kulturelle Einflüsse geprägt sind.[perfectpullquote size=“15″ align =“left“ cite=“Nicolas Rose 2006: S. 465″]“Others have suggested that the expansion [of psychiatry] is part of a social and cultural malaise, in which individuals increasingly define problems of living as disorders in need of treatment.“[/perfectpullquote]Zum einen, da auch ‚Wohlergehen‘ und gesellschaftliche – und damit zumeist verbunden auch eigene Ansprüche ans Individuum variieren. Nikolas Rose beschreibt beispielsweise eine derzeitige Situation, in der mit der Verbreitung der Psychiatrie auch alltägliche Sorgen und Probleme des Lebens zunehmend pathologisiert werden. Zum anderen aber auch, da je nach aktuellem medizinischen Diskurs und Diagnosekriterien unterschiedliche Krankheitsbilder definiert werden. Die Geschichte der Depression, die Alain Ehrenberg in seinem viel beachteten Buch „Das erschöpfte Selbst“ zeichnet, ist geprägt von Überschneidungen mit anderen geistigen Krankheiten seit dem Ende des 19. Jahrhunderts33 und Veränderungen basierend auf medizinischen Innovationen und Disziplinen, wie dem Aufkommen von Anti-Depressiva und dem Popularitätszuwachs der Neuropsychologie mit ihren neuartigen Untersuchungsmethoden.34 Historische Analysen wie die von Patrick Kury arbeiten derweil heraus, wie unterschiedliche Epochen auch unterschiedliche Krankheiten hervorbringen, welche das jeweilige gesellschaftliche Verständnis und die damit einhergehenden Transformationsprozesse verkörpern.35 Psychische Erkrankungen sind somit auch historisch betrachtet keine feststehenden Kategorien, sondern wandelbar und immer geprägt von medizinischem Diskurs und gesellschaftlichen Strukturen.36
[su_spacer size=“35″]
Subjektivierung von Gesundheit
Im Zuge der Subjektivierung von Gesundheit wandelt sich jedoch zunehmend der Fokus der Verantwortung von gesellschaftlichen Strukturen hin zum Einzelnen. So beschreiben es auch Heinemann & Heinemann beispielhaft in ihrer Analyse zur gesellschaftlichen Konstruktion von Burnout.37 Wurden zunächst noch das Arbeitsumfeld und die Werte der Leistungsgesellschaft als strukturelle Begünstigungen für das Burnout-Syndrom gesehen, so beobachten sie einen zunehmenden medialen und medizinischen Verantwortungs-Shift hin zum Individuum.38 Auch dieser geht einher mit einem „individuellen Selbstoptimierungsauftrag“39 und der Verantwortung sich selbst zu managen und gesund zu werden bzw. bleiben. Selbsttests und Selbsthilfeprogramme scheinen dabei nur ein weiterer Schritt in diese Richtung zu sein. Der so entstehende ‚Gesundheitswahn‘, wie Monica Greco es formuliert, welcher Alltägliches im Leben problematisiert und Optimierungszwängen unterwirft, erweckt dabei den Anschein von Gesundheit als einen feststehenden Zustand, der maßgeblich durch rationale Entscheidungen verbessert oder erhalten wird. Somit werde Gesundheit zu einem Barometer, an denen die moralische Handlungsfähigkeit und die ‚personal agency‘ des Individuums gemessen würden.40 Kritisch hierbei: Biologische und gesellschaftliche Faktoren spielen dabei zunehmend nur als ‚Handicap‘ eine Rolle und werden Umstände, an denen nach eigenen Kräften zu arbeiten sei. Gleichzeitig würden die Kategorien ‚Gesundheit‘ und ‚Krankheit‘ zu Trägern der Selbstproduktion und Ausübung von Subjektivierung, versehen mit den Möglichkeiten der Wahl und des Willens.41
[su_spacer size=“35″]
Die wechselseitige Produktion des neoliberalen und neurotischen Subjekts
Doch diese Wahlmöglichkeiten und Selbstverantwortung beinhalten immer eine gewisse Unsicherheit. Diese ist laut Greco in neoliberalen Gesellschaftsstrukturen ohnehin beispiellos hoch. Denn das neoliberale Subjekt ist dazu angehalten, rational, mündig und entschieden sein Leben zu bestreiten, um das eigene Leid und Risiken zu minimieren. Doch die vielen Optionen und Ungewissheiten mache es ihm nahezu unmöglich, diesen Erwartungen realistisch zu entsprechen, was wiederum Ängste und Unsicherheiten – und mit ihnen das neurotische Subjekt42 produziere. Das als affektives Wesen mit Ängsten und Unsicherheiten anerkannte Subjekt wiederum ist angehalten, sich selbst zu managen und durch rationale Handlungen seine Unsicherheiten zu minimieren und Ängste zu kontrollieren, um das eigene Wohlbefinden zu steigern.
[su_quote cite=“Monica Greco 2016: S. 74″]Das ängstliche Subjekt ist jenes, das zugleich nach Perfektion strebt – nach perfekter Information, perfekter Gesundheit, perfekter Autonomie – und unausweichlich daran scheitert, diese Erwartungen zu erfüllen.[/su_quote]
Dieses Scheitern werde abermals mit negativen Gefühlen und weiteren Ängsten und Unsicherheiten gestraft – ein Teufelskreis aus neurotischem und neoliberalem Subjekt, welche sich stetig gegenseitig bedingen und produzieren.
[su_spacer size=“35″]
Zwischenfazit
Wir sehen also, wie der Wunsch nach Selbsterforschung, welchen wir bei den psychologischen Selbsttests unterstellen, auch immer einen Selbstoptimierungsauftrag und ein unrealistisches Idealbild enthält, auf das hingearbeitet wird. Dieses Idealbild stellt bei Nichterfüllung jedoch eine Quelle eben jener negativen Gefühle dar, die es zu verhindern galt und verfestigt, was als ‚krank‘ und ‚gesund‘ gilt. Die zunehmende Verantwortung sich selbst um die eigene (mentale) Gesundheit zu kümmern, diese zu erhalten und zu optimieren führt jedoch zu einem vermehrten Risikobewusstsein und einer steigenden Unsicherheit. Diese sind charakteristisch für Bürger*innen in neoliberalen Gesellschaftsstrukturen und können abermals in einem steigenden Bedürfnis nach Wissen über sich und die Krankheitsbilder münden, um sinnvolle Handlungsentscheidungen treffen zu können. Das dadurch bedingte Konzept des neurotischen Subjekts möchte ich im Folgenden mit dem Interview mit Susanne in Verbindung bringen.
[su_divider top=“no“ style=“dotted“ size=“1″ margin=“30″]
Interview mit Susanne
Susanne43 ist Ende 50 und arbeitet in einer leitenden Führungsposition. Aufgrund ihrer typischen „60 oder 70-Stunden Arbeitswochen“ mit mindestens 6 Tagen die Woche, hat sie schon häufiger von Personen in ihrem Umfeld zu hören bekommen, sie müsse doch Burnout-gefährdet sein. Wegen ihres Grundwissens um die Ursachen sah sie diese Gefährdung bisher jedoch weniger, denn sie differenziert stark zwischen Erschöpfung – die sie wie sie zugibt schon lange verspürt – und Burnout. Erschöpfung sei dabei etwas aktiv selbstgemachtes, Burnout dagegen etwas, „wo gar nichts mehr geht, ob du willst oder nicht“. Als sie eines Tages auf einen Burnout-Selbsttest im Internet stößt, beschließt sie diesen aus Interesse zu machen – und bezeichnet das Ergebnis als „niederschmetternd“. Es wertet ihr aus, „in höchstem Maße Burnout-gefährdet“ zu sein und rät ihr, ihre Lebensumstände zu ändern.
[su_spacer size=“30″]
Der Bruch im Selbstbild und die Konsequenzen
Rationale Entscheidungen zu treffen, um durch Verhaltensänderungen ein Risiko zu verringern, entspricht dabei ganz dem neoliberalen Ideal. Auffällig ist in diesem Fall jedoch, dass, obwohl Susanne anerkennt, dass viele Probleme strukturell bedingt sind, da es „uns allen so geht“, versucht wird dieses Risiko mit eigenen Handlungen zu verringern, ohne strukturell etwas zu ändern oder ändern zu können. So delegiert Susanne zunehmend kleine Aufgaben weg, steigt „jede Treppe“ und geht vermehrt Spazieren als Ausgleich für wenig Sport. Sie nimmt sich dabei die Fragen aus dem Burnout-Test als Hilfestellung. Diese recht einfachen, aufs Leben bezogenen Fragen kämen ihr immer wieder in den Kopf, was dazu führt, dass sie ihr Alltagsverhalten auch immer wieder in Bezug zu den Symptomatiken und dem Krankheitsbild stellt und diese dahingehend überprüft.
[su_quote cite=“Susanne“]Da kommen mir immer wieder diese Fragen in den Sinn. Zum Beispiel ‚Fühlen Sie sich häufiger erschöpft?‘. Ich glaube da war auch sowas wie ‚Neigen Sie dazu abends zum Abspannen ein Glas Wein zu trinken?‘. Also lauter solche Fragen waren das. Da fällt mir mein Verhalten mehr auf. Und das hat dann so Folgen, dass ich denke: Ne, ich will nicht jeden Abend ’n Glas Wein trinken! Oder: Ach Gott, jetzt hab‘ ich irgendwie schon wieder die ganze Woche ’n Glas Wein getrunken obwohl ich doch eigentlich nur am Wochenende Alkohol trinken will… Also das fiel mir früher glaube ich nicht so wirklich auf.[/su_quote]
Diese beiden Beispiele aus dem Interview zeigen jedoch auch, wie übliche und nicht konkret mit Krankheitsbildern gekoppelte Verhaltensweisen oder Empfindungen somatisiert werden können. Häufigere Erschöpfung oder das Trinken von einem Glas Wein zum Entspannen sind per se keine krankheitsbezogenen Symptome oder Auslöser. Dies deckt sich mit Roses Beobachtung, laut der Alltägliches zunehmend pathologisiert und als behandlungswürdig erachtet wird.44 Wird das Subjekt sich diesem Alltäglichen an sich selbst aber zunehmend bewusst, und bringt es dies mit seiner Burnout-Gefährdung in Verbindung, kann dies zusätzlich zu Angst führen – ebenso wie der Versuch das Verhalten anzupassen und daran zu scheitern. Somit kann dies das Selbstbild als gefährdete Person stabilisieren oder sogar verschlimmern.
[su_spacer size=“30″]
Selbstermächtigung durch einen Selbsttest?
Der „Aufmerker“, wie sie den Selbsttest bezeichnet, wird aber von ihr tatsächlich nicht als eine Diagnose wahrgenommen. Der Selbsttest lässt dabei dem Testenden deutlich mehr Freiraum sich mit der Auswertung auseinanderzusetzen, anders als dies bei einem menschlichen Gegenüber der Fall ist.
[su_quote cite=“Susanne“]Ich glaube die Hürde bzw. die Schwelle zu einem Menschen zu gehen, der sich damit auskennt ist deutlich höher, weil es nicht mehr anonym ist. Weil ich in Beziehung trete zu einer Person und das anders an mich ranlassen muss, was sie mir erzählt. Damit muss ich mich direkt und sofort auseinandersetzen. Also ich glaube so ’n Selbsttest den kann ich machen, zur Seite legen und mir überlegen, was ich damit mache, aber ich muss nicht sofort reagieren oder dann die Frage beantworten ‚Ja was machst du denn jetzt damit?'[/su_quote]
Neben dem Aspekt der geringeren Hürde, der hier angesprochen wird, findet sich auch der Aspekt der Verbindlichkeit einer Diagnose wieder. Es lässt der getesteten Person die Freiheit, sich selbst im eigenen Tempo und Werteschema mit dem Ergebnis auseinander zu setzen, es gegebenenfalls auch abzulehnen. Während in klassischen medizinischen Institutionen Diagnosen und Behandlungen zusammengehören und das Machtgefälle zwischen Patient*in und Ärzt*in deutliche Asymmetrien aufweist, stellen Selbsttests zu einem gewissen Grad Werkzeuge der Selbstermächtigung dar, indem sie diese Beziehungen auflösen und dem Nutzer Werkzeuge in der Sprache der Medizin an die Hand geben auf die sie sich auch in Arztgesprächen berufen können.45
[su_spacer size=“30″]
Selbstthematisierung und (fremd-)Reflektion
Susanne erzählt mir, dass niemand in ihrem Umfeld wirklich über den Grad ihrer Erschöpfung Bescheid weiß und vielmehr noch, dass sie versucht dies aktiv zu verbergen, um ihr Selbstbild nicht zu gefährden.
[perfectpullquote size=“15″ align =“right“]Interviewer: Kommunizierst du das?
Susanne: Sowas? Was ich dir eben erzählt hab?
I: Ja
S: Nein! Das weiß keiner außer dir jetzt.
I: Warum nicht?
S: (…) Weil zu meinem Selbstbild gehört, dass ich zuverlässig funktionier.[/perfectpullquote]
Dennoch hat der Selbsttest einen konkreten Einfluss auf ihr Selbstbild, da sie sich erst ab dem Zeitpunkt des Tests selbst als ‚Burnout-gefährdet‘ wahrnimmt und ihr Verhalten bewusster anpasst, sich verstärkt informiert und somit dem Krankheitsbild entgegenwirken will. Der Ausdruck des Selbst findet zwar nicht wie Schroer es beschreibt gegenüber anderen Personen statt, welche dieses reflektieren und das Selbst somit mit konstituieren.46 Diese Position der Fremdreflektion nehmen jedoch die dahinterliegenden Berechnungen und Algorithmen ein. Wir sehen also, wie ein Selbsttest – auch bei geringerer Autorität – das Selbstbild mit beeinflussen kann und sowohl Chancen als auch Gefahren in Bezug auf die eigene mentale Gesundheit birgt.
[su_divider top=“no“ style=“dotted“ size=“1″ margin=“30″]
Diskussion und Ausblick
Dass Online-Selbsthilfe und Online-Selbsttests in Zukunft an Relevanz gewinnen werden, ist recht wahrscheinlich. Die Kosteneffizienz47 und die voranschreitende Digitalisierung in allen Lebensbereichen bringen immer mehr Anbieter hervor. Derweil führt die steigende Relevanz und Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen,48 aber auch die zunehmende Selbstthematisierung, wie wir sie mit der Verbreitung sozialer Netzwerke beobachten, zu einer zunehmenden Auseinandersetzung mit diesem Thema auch auf individueller Ebene. Es verwundert also nicht, dass Krankenkassen, politische und medizinische Verbände aber auch vor allem die Privatwirtschaft immer mehr an diesem Thema interessiert sind. Zu beobachten ist dabei eine beispiellose Vermischung von Privatwirtschaft und Medizin,49 die mit einem individualisierten Heilsversprechen wirbt50 und sich der „objektiven Wahrheit“ der Medizin bedient.51 Dabei stellt die Selbsthilfe eine fast unerschöpfliche Profitquelle dar, bei der Vielzahl an Optimierungspotenzialen und Unsicherheiten in neoliberalen Gesellschaftsstrukturen.
Ich möchte hier das große Potenzial der neuen digitalen Angebote im Bereich mentaler Gesundheit nicht kleinreden und auch nicht die medizinischen Dimensionen oder die Beeinträchtigungen für psychisch erkrankte Menschen marginalisieren. Der erleichterte Zugang, der Selbstermächtigungs-Aspekt und die Hilfestellung für bewusstes, gesundheitsförderndes Handeln oder angemessene Behandlungen sind Aspekte, die für viele Menschen eine große Hilfe mit diesem schwierigen Thema darstellen können. Zu erwähnen ist hier auch der Inklusionsaspekt, da Regionalität, Sprache, finanzielle Mittel und bis zu einem gewissen Grad auch kultureller Hintergrund eine deutlich geringere Rolle in der psychotherapeutischen Versorgung spielen, als dies bisher der Fall ist. Doch da es oftmals nicht reicht die Frage „Bin ich krank?“ subjektiv zu beantworten, sondern das Leiden in körperlichen Messungen oder psychologischen Kodes von medizinischen Autoritäten bestätigt werden muss, um anerkannt zu werden,52 kommen der Medizin und der Psychologie hier eine besondere Rolle zu, ängstlichen und orientierungslosen Personen nicht zusätzlich Angst zu machen. Dafür müssen aber die etablierten Kategorien und Auswertungsschemata hinterfragt und gesellschaftlichen und zeitlichen Umständen angepasst werden. Die bisher vernachlässigten Bedeutungssysteme, Nutzungsmotivationen und das Selbstbild der Nutzer*innen müssen darüber hinaus deutlich stärker in zukünftige, idealerweise interdisziplinäre Forschungen hierzu mit einbezogen werden53 – ein Appell, der sich nicht nur an die Medizin und Psychologie, sondern auch an die Medizinanthropologie richtet, die hier doch eigentlich ihre Stärken hat.
[su_divider]
[su_spoiler title=“Exkurs: Kritik am Aufbau der psychologischen Online-Selbsttests“ style=“default“ icon=“chevron“]
Die Schwierigkeit der psychologischen Screening-Tests, welche zumeist 1:1 in den digitalen Bereich übertragen werden, ist, subjektive Empfindungen quantifizierbar zu machen. Das häufig verwendete Auswertungsschema der Selbsttests ist, Antworten mit einfachen Punktzahlen zu versehen und zusammenzurechnen. Neben dem Fehlen von qualitativen Auswertungen, Nachfragemöglichkeiten seitens Experten bezüglich Verständnis und Relevanz und Verbindungen zwischen einzelnen Kategorien, kommt hier auch die aus der Statistik bekannte ‚Tendenz zur Mitte‘ hinzu. Dieses Prinzip besagt, dass Befragte nur selten Extremwerte wählen (in diesen Fällen also 0 Punkte), was zu einer schnellen Kumulation von Punkten führt. Da bereits ab geringen Punktzahlen oftmals „leichte“ Auffälligkeiten ausgewertet werden, geschieht es sehr schnell, dass Personen Auswertungen in (mindestens) diesem Bereich erhalten. So geben einige Auswertungen des Standard-Screening-Tests für Depressionen (PHQ-9) bereits ab einem Punkt54 an, eine „minimale Depression“ zu haben. Dieses direkte in-Bezug-setzen zu einer Diagnosekategorie kann, wie ich hier argumentiere, negative Auswirkungen auf das Selbstbild haben und dazu führen, dass sich auch gesunde Menschen selbst als psychisch krank oder gefährdet definieren.55
[su_spacer size=“35″][su_slider source=“media: 5826, 5801, 5799, 5800″ link=“lightbox“ width=“900″ height=“900″ autoplay=“10000″][/su_spoiler]