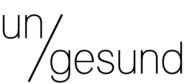Forschungsfrage: Wie gestaltet sich der aktuelle Diskurs um die mentale Gesundheit von Studierenden?
Worum es hier geht
Unser Zusammenleben basiert und funktioniert aufgrund gemeinsamer Werte und Normen. Dabei entwickeln und verändern sich diese Werte der Gesellschaft in immerwährenden Aushandlungsprozessen. Innerhalb eines solchen Aushandlungsprozesses gibt es meist ein dominierendes Meinungsbild, dass sich manifestieren und in einer Kultur verankern kann.1
Diese Aushandlungsprozesse zu erforschen kann Aufschluss über die Entwicklung einer Gesellschaft geben und Zusammenhänge sichtbar machen, aus denen der Impuls für konkrete Handlungskonzepte hervorgehen kann.2
Auf dieser Seite stelle ich den Verlauf und die Ergebnisse einer eigenen Forschung vor, bei der ich die aktuellen Aushandlungsprozesse um die mentale Gesundheit von Studierenden analysiere und basierend darauf Thesen und Fragestellungen formuliere.
Diesen Aushandlungsprozess verstehe ich im Sinne von Michel Foucaults Begriff des Diskurses und schaffe einen Zugang durch eine Mediendiskursanalyse. Diese ergänze ich durch drei Experteninterviews.
Der Diskurs als Teil von Foucaults Gouvernementalitäts-Theorie begründet die Bezugnahme auf diese Theorie in der Auswertung. Die Ergebnisse der Analysen, die zum Großteil auf gesamtgesellschaftliche Veränderungen als Begründung für eine sich verschlechternde mentale Gesundheit hinweisen, werden durch die Theorien des Soziologen Hartmut Rosas zu Beschleunigungstendenzen gestützt.
Wie ich auf das Thema gekommen bin
Von allen Stationen in meinem Leben fordert mich das Studium bisher am meisten heraus. Dabei ist es nicht immer die intellektuelle Ebene, sondern häufig das Zeitmanagement, ein gewisser Druck, zu viele Optionen, das Gefühl, überfordert zu sein und ständig Stress zu haben. Ich begegne Kommiliton*innen, denen es ähnlich geht und frage mich: wo kommt all der Stress und Druck her?
Dann lese ich, dass sämtliche aktuellen und großen Studien zum Thema Gesundheit beweisen würden, dass psychische Erkrankungen in der gesamten Gesellschaft zunehmen, besonders betroffen seien Studierende, häufig von Depressionen.3 Woran liegt es denn nun aber, dass die mentale Gesundheit von Studierenden besorgniserregend in den Fokus gerückt ist? Erkranken tatsächlich mehr oder ist die Akzeptanz für psychische Erkrankungen einfach gestiegen, weshalb die Hilfssysteme mehr genutzt werden und die Diagnosen zunehmen? Oder sind Depressionen und Burnout schlichtweg die Krankheiten unserer Zeit, ist der Wandel unserer Gesellschaft, die Digitalisierung und Globalisierung, für die wachsenden Zahlen verantwortlich?
Der Einstieg in das Forschungsfeld
Der Zugang zu einem prekären Forschungsfeld wie dem der Gesundheit bedarf einiger Vorsicht und Rücksichtnahme. Zudem soll es in diesem Fall logisch mit dem Blickwinkel der Kulturanthropologie verknüpft werden. Ausführliche Informationen zum Einstieg in das Forschungsfeld gibt es hier.
Im Rahmen der Mediendiskursanalyse habe ich mich für diese Forschung auf online Content aus den letzten fünf Jahren beschränkt; online, weil sich hier die Gruppe der Studierenden primär aufhält, sie den Content mitbestimmt und dieser die Gruppe wiederum maßgeblich beeinflusst; aus den vergangenen fünf Jahren, um eine gewisse Aktualität zu gewährleisten. Die Artikel stammen aus reichweitenstarken Online-Magazinen, inklusive solcher, die explizit Studierende ansprechen. Die aktuellen Berichte der Krankenkassen, Aufklärungstexte staatlich geförderter Stiftungen, sowie die Beschreibungstexte aller Hamburger Universitäten zu ihrem jeweiligen psychologischen Beratungsangebot wurden außerdem mit einbezogen. Die Beiträge und Artikel wurden auf Ursachen, Symptome und Behandlungsstrategien im Zusammenhang mit mentaler Gesundheit untersucht. Die Ergebnisse wurden dann verglichen, gewichtet und entsprechend zusammengetragen. Auf diese Weise versuche ich herauszukristallisieren, was in diesem Diskurs als wahr verhandelt wird.
Die Mediendiskursanalyse wurde durch drei Experteninterviews ergänzt. Hier habe ich den Leiter der psychologischen Beratungsstelle der Universität Hamburg, Bernd Nixdorff, dazu befragt, wie sich seine Arbeit mit den Studierenden verändert hat und was für Gründe er dahinter vermutete. Eine Mitarbeiterin des Peer-to-Peer Projektes, ein Beratungsangebot von Studierenden für Studierende der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg (HAW), erzählte mir, mit welchen Problemen sich Studierende an ihr Projekt wenden. Und eine in Hamburg praktizierende Kinder- und Jugendpsychiaterin habe ich dazu befragt, welche Veränderungen sie in Bezug auf die mentale Gesundheit von jungen Menschen wahrnimmt und welche Gründe sie dafür sieht. Diese Forschung soll als Einstieg in das Thema dienen und einen ersten Überblick über die Beschaffenheit des Diskurses vermitteln.
Einblick in den Forschungsstand
Lange Zeit war die mentale Gesundheit in der Gesellschaft gar kein Thema. Wer nicht mit den vorherrschenden Anforderungen klarkam oder aus dem Rahmen fiel war verrückt, besessen und später eben krank und ein Fall für die Ärzte.4
Einen Durchbruch auf dem Feld der psychischen Gesundheit erlangte der Gesellschaftswissenschaftler Michel Foucault. Die Abgrenzung des „Normalen“ vom „Unnormalen“ als feststehende Kategorien würde sich seiner Auffassung nach in gesellschaftlichen Prozessen manifestieren. Die Entwicklung dieses gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses sei dabei abhängig von den Machtstrukturen und damit einhergehenden Wissensbeständen.5 Foucault beschäftigt sich mit der geistigen Verfassung und deren Zusammenspiel mit der Gesellschaft in seinen Werken „Psychologie und Geisteskrankheit“ (1954) und „Wahnsinn und Gesellschaft“ (1961). Dabei analysiere er die Entwicklung unserer Kultur, in der wir diese Abgrenzungen vornehmen, als einen historischen Vorgang, in dem der Prozess von Ablehnung und Ausgrenzung als konstruktiv für System und Kultur gewesen sei. Er stelle weiter die These auf, dass mit der Industrialisierung und den neuen gesellschaftlichen Strukturen kein Platz mehr für die „Geisteskranken“ gewesen sei.6
Das Thema der mentalen Gesundheit beschäftigt heute neben der Medizin und Psychologie noch häufiger auch andere Disziplinen, darunter die Kultur- und Geisteswissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, wie die Soziologie, aber auch die Erziehungs- und Bildungswissenschaften. Sie alle bieten verschiedene, oft interdisziplinäre Perspektiven auf Ursachen und Symptome psychischer Erkrankungen und beeinflussen damit, als Institutionen mit Macht und Einfluss auf das Wissen, gleichzeitig die Wahrnehmung dieses sehr komplexen Feldes.7
Der Soziologe Hartmut Rosa beispielsweise beschreibt mit seiner Theorie zu Beschleunigungstendenzen die zeitverändernden Auswirkungen der globalisierten und digitalisierten Welt. Neben einem komplexen Strukturwandel sieht Rosa besonders die negativen Auswirkungen auf das Subjekt in Form von mentalen Belastungen und Überforderung als Problem an.8
Mentale Gesundheit in den Medien
Als Einstieg in die Diskursanalyse dient ein Blick auf die (sozialen) Medien. Hier taucht das Thema der mentalen Gesundheit, besonders von Depression und Burnout, explizit bei Studierenden bzw. jungen Menschen, sehr häufig auf. So gibt es zahlreiche Reportagen, Dokumentationen und Radiobeiträge. Stichwörter, die hier immer wieder fallen, sind: Leistungsgesellschaft, Zeitknappheit sowie Druck und Stress. Das Motiv des Stresses und in diesem Zuge das der Stressvermeidung oder -linderung taucht ebenso in Werbung und Marketingkampagnen auf.
Stress und Überforderung sind Bestandteil von Kunstveranstaltungen, wie einem Poetry Slam oder von verrückten Design-Ideen, die Entschleunigung in ’ s Haus bringen sollen.
Auch auf den sozialen Plattformen stolpert man immer wieder über das Thema der mentalen Gesundheit, auf Instagram-Kanälen, die extra dafür designt sind. Aber auch große Marken, besonders im Bereich Mode und Lifestyle, beschäftigen sich im Rahmen verschiedener Hashtags mit der mentalen Gesundheit, besonders bei jungen Menschen. Auch Prominente setzen sich für ein neues Verständnis von psychischen Erkrankungen ein.
Eine Y-Kollektiv Reportage zum Thema Depressionen, die mich u.a. auf mein Forschungsthema gebracht hat.
Die Forschungsergebnisse
Mediendiskursanalyse
Der Anstieg psychischer Erkrankungen als Indikator einer sich verschlechternden mentalen Gesundheit wird in den meisten Fällen mit den aktuellen Berichten der Krankenkassen begründet, diese verzeichnen eine besondere Zunahme bei Studierenden, dies belegen auch die universitären Beratungsstellen. Außerdem wird sich in vielen Fällen auf die Aussage der Weltgesundheitsorganisation (WHO) berufen, dass Depression die Volkskrankheit des 21. Jahrhunderts sei. Immer wieder begegnet man aber auch dem Faktor der Enttabuisierung. Insgesamt sei die Gesellschaft beim Thema mentale Gesundheit in den vergangenen Jahren aufgeklärter und offener geworden. Die Inanspruchnahme von Hilfsangeboten im Spektrum der mentalen Gesundheit sei akzeptierter und würde daher auch häufiger genutzt werden.
Experteninterviews
Die Ergebnisse der Experteninterviews stimmen zum Großteil mit den gewonnenen Erkenntnissen aus der Mediendiskursanalyse überein, ergänzen diese aber noch um den spezifischeren Ausschnitt der Studierenden.
So wird die Individualität von Problemen und Umgangsmechanismen mit verschiedenen gesellschaftlichen und studienbezogenen Herausforderungen deutlich angesprochen. Der leitende Psychologe der psychologischen Beratungsstelle der Uni Hamburg definiert als Problem oder Störung, all das, was die „Arbeits-, Liebes- und Genussfähigkeit einschränkt“. Dies sei in jedem Fall abhängig vom Subjekt.
Auch hinterfragen die interviewten Experten kritisch, ob psychische Erkrankungen wirklich zugenommen haben. Zwar geben alle drei Befragten an, dass ihre jeweiligen Angebote in den vergangenen Jahren stetig mehr genutzt werden, vertreten aber auch die Auffassung, dass die abnehmende Stigmatisierung psychischer Erkrankungen, genau wie das wachsende Angebot, die Nachfrage erhöhen. Der Psychologe macht dafür unter anderem prominente Menschen verantwortlich, die durch ihre Offenheit und Reichweite die Gesellschaft maßgeblich mitprägen. Auch die Peer-to-Peer Mitarbeiterin meint, dass die stetige Auseinandersetzung mit diesem Thema eine gewisse Offenheit der Menschen bedingt.
Mediendiskursanalyse
Der Begriff Stress begegnet einem bei der Suche nach Gründen für eine allgemein verschlechterte mentale Gesundheit immer wieder, ohne genau definiert zu werden, aber mit einem hohen Identifikationspotenzial. Stress würde immer häufiger zu Dauerstress werden, was weder dem Körper noch der Psyche guttäte. Weniger Bewegung und hohe Selbstanforderungen seien weitere Trends unserer Gesellschaft, die sich negativ auf unsere mentale Gesundheit auswirken würden.
Im gesamtgesellschaftlichen Kontext, der genauso Studierende betrifft, werden Ursachen dafür immer wieder in den neuen vernetzten Strukturen der globalen Welt und einem umkämpften Arbeitsmarkt gesehen; alles werde hektischer. Auch die Digitalisierung und die vielen sozialen Netzwerke tauchen in Erklärungsversuchen immer wieder auf; hier sei der Benutzer einer ständigen Konkurrenz ausgesetzt und müsse sich dauerhaft selbstbehaupten.
Zudem würden Probleme und besonders Stress oft nicht ernst genug genommen werden, auch weil immer noch ein großes Schamgefühl mit psychischen Erkrankungen verbunden sei. Symptome werden als solche nicht erkannt oder in Drucksituationen nicht weiter beachtet. Missachtung der Symptome oder Isolation als Folge würden die Situation meist noch verschlimmern.
Experteninterviews[su_pullquote align=“right“ class=““]„Also man muss mit 28 den Master haben, drei Fremdsprachen sprechen, Praktikum haben. Man muss dann auch noch eine erfolgreiche Beziehung haben, vielleicht liebevolle Eltern sein, politisch engagiert, bewusst sich ernähren und kleiden[…].“9[/su_pullquote]Eine Veränderung, die der Psychologe und seine Kollegen über die Jahre ebenfalls festgestellt haben, ist das vermehrt auftretende Empfinden von Stress, der mittlerweile als eigene Kategorie in der Beratungsstelle aufgenommen wurde. Damit einher gehen würden ein hoher Selbstoptimierungsdruck und Versagensängste.
Die Experten sehen ebenfalls die wachsenden gesellschaftlichen Anforderungen an junge Menschen als Grund für häufige Inanspruchnahme der Beratungs- und Therapieangebote. Leistungsdruck und Zukunftsangst würden sich auf Grund hoher Ansprüche an den Arbeitnehmer breitmachen. Häufig werden Sport und soziale Kontakte als Konsequenz vernachlässigt, was alle drei als negative Einflüsse auf die mentale Gesundheit bewerten.
Gleichzeitig wüchsen aber auch die Möglichkeiten und Freiheiten, was wiederum zu Entscheidungsschwierigkeiten und Überforderung führen würde. Die Psychiaterin beobachtet, dass der Anspruch an Selbstverwirklichung heute höher scheint.
Auch die erhöhte Verfügbarkeit und dadurch nachlassende Konzentrationsfähigkeit aufgrund unserer digital vernetzten Welt beobachten die Experten immer wieder. Genau wie die ständige Informationsflut und der dauernde Vergleich mit anderen. Gleichzeitig lobt vor allem die Peer-to-Peer Mitarbeiterin die ständige Thematisierung von mentaler Gesundheit in sozialen Netzen.
Mediendiskursanalyse
[su_pullquote align=“right“ class=““]„Wenn man die Universität als reine Ausbildungsinstitution betrachtet, verliert sie ihre Reflexions-, Korrektur- und Reparaturfunktion.“ 10[/su_pullquote] In Bezug auf das Studium wird häufig die Studienstruktur als Mitverursacherin beschuldigt. Dabei rückt vor allem die Bologna-Reform immer wieder in den Fokus. Kritische Stimmen werfen der Reform (und ihren Vertretern) vor, für Leistungs-, Konkurrenz- und Zeitdruck verantwortlich zu sein, zudem leide die Qualität unter den stärkeren Regulierungen und kreative Freiräume würden fehlen. Der Begriff des Bulimie-Lernens taucht immer wieder auf und soll beschreiben, dass sich Stoff nur noch zur Wiedergabe angeeignet werde und nicht richtig verarbeitet und verstanden werde.
Auf der anderen Seite ermögliche die verschulte Uni aber vielen auch einen Zugang zu diesem Bildungsweg, was überwiegend positiv bewertet wird. Das Studium als Lebensabschnitt dient ebenso als Erklärungsversuch. Die habituelle Änderung im Vergleich zur Schule sei auch eine Phase, in der man sich immer wieder mit seiner eigenen Identität auseinandersetzen müsse. Hinzu kommen finanzielle Aspekte, beispielsweise der aktuelle Wohnungsmarkt sowie die Notwendigkeit eines Nebenjobs.
Experteninterviews
Auch bei den Experten wird die Studienstruktur anteilig als Grund für steigenden Druck und Stress gesehen. Zumal die strengere Regulierung, in Bezug auf Orientierung in Form von Strukturierung, genauso als positiv gesehen wird.
Die Peer-to-Peer Mitarbeiterin bewertet die Studienanforderungen besonders in Kombination mit Job, Freizeit, etc. als sehr hoch. Dass die vorgegebene Regelstudienzeit, insbesondere auf die finanzielle Belastung bezogen, trotzdem ein Stressfaktor ist, bestätige sich. Vielen Studierenden, die ihr Angebot nutzen, würden eine gewisse Flexibilität vermissen. Die Psychiaterin erklärt, dass bereits ihre Patienten den Schulstoff als zu viel wahrnehmen. Ebenso wird das Studium als Zeit der Umbruchphase erkannt und dementsprechend als besonders herausfordernd eingestuft.
Mediendiskursanalyse
Insgesamt wird deutlich, dass die Strategien der Krankenkassen sowie Universitäten und Hochschulen, als auch der Meinungsträger in Artikeln für ausreichend Präventionsmaßnahmen und Aufklärung stimmen. Mit dem Fokus auf digitalen Lösungen als Reaktion auf gesellschaftliche Phänomene wie Zeitmangel und Leistungsdruck wird deutlich, dass hier der gesellschaftliche Wandel, den u.a. auch Rosa, anspricht deutlich wahrgenommen wird und neue Strukturen bedingt.[su_pullquote align=“right“ class=““]„Nicht im Stummen zu leiden und sich Hilfe zu suchen zeugt von Stärke, Selbstliebe und Selbstverantwortung.“ 11[/su_pullquote] In den meisten Fällen wird dazu geraten, sich außenstehende Hilfe zu suchen und seine Probleme und Schwierigkeiten anzusprechen. Der Austausch über die eigenen Belastungen könne dabei helfen, einen neuen Blick auf die Dinge zu erlangen. Auch die Scham vor dem eigenen Problem oder der eigenen Schwäche wird dem Betroffenen immer wieder versucht zu nehmen.
Anonymität und Zugänglichkeit im Rahmen von Hilfsangeboten werden immer wieder betont. Eine individuelle, auf die einzelne Person abgestimmte Behandlung scheint unumgänglich; begründet wird dies zumeist damit, dass jeder auf gleiche Faktoren unterschiedlich reagiert und damit die Ursachen für das eigene Leiden stets individuell sind. Dies sollte somit auch von der Behandlung erwartet werden.
In den meisten Fällen wird bei einer gewissen Schwere der mentalen Erkrankungen, wie bei manifesten Depressionen, Angst- oder Essstörungen zu einer psychotherapeutischen Behandlung geraten, teils solle diese durch Medikamente begleitet werden.
Experteninterviews
Der Berater der Uni Hamburg erklärt, dass diverse Beratungsangebote und Workshops vielen Studierenden bereits so gut helfen, dass die Probleme nicht weiterwachsen. Hilfe zur Selbsthilfe, Erfahrungsaustausch und Perspektivwechsel sind die üblichen Behandlungsmethoden der universitären Angebote.
Aber auch die Überweisung an Ärzte und Therapeuten gehört weiterhin zu den Aufgaben des Psychologen, da in diesen Fällen das eher kurzzeitige Angebot der Uni keine Abhilfe leisten kann. Es könne keine Therapie ersetzen, sondern eben bei weniger ausgeprägten Problemen helfen und diene meist auch der Prävention oder begleitend zur Therapie. Besonders beim Peer-to-Peer Projekt wird auf den Austausch auf Augenhöhe und das gegenseitige Unterstützen gesetzt.
Fazit
Aus der Mediendiskursanalyse und den Experteninterviews geht deutlich hervor, dass die Debatte über die mentale Gesundheit in der Gesellschaft aktuell und facettenreich ist. Die gestiegenen Zahlen der Diagnosen psychischer Erkrankungen und der Inanspruchnahme von Beratungsangeboten wird durch verschiedene Faktoren begründet, die sich gegenseitig ausschließen, aber auch bedingen können.
Die Ursache wird häufig in der globalisierten und digitalisierten Welt gesehen, in der uns der umkämpfte Arbeitsmarkt und die erhöhte Verfügbarkeit so sehr stressen würden, dass wir Sport und soziale Kontakte zwangsläufig vernachlässigen würden. Gleichzeitig werden diese neuen Strukturen dafür verantwortlich gemacht, dass die Akzeptanz gegenüber mentalen Erkrankungen gestiegen sei.
Studierende seien besonders betroffen, da sie sich in einem Lebensabschnitt befänden, in dem sie bereits mit vielen verschiedenen Herausforderungen konfrontiert seien. Diese scheinen noch zugenommen zu haben; höhere finanzielle Belastungen, gestiegene Selbstanforderungen und Versagensängste. Dies wird unter anderem auf die Bologna-Reform geschoben. Gleichzeitig habe aber auch der Optimierungsdruck durch die vielen Einflüsse und Möglichkeiten zugenommen.
Die mentale Gesundheit wird stets als etwas Persönliches und Individuelles verhandelt. Vor allem bei feststehenden Krankheitsbildern wird auf Therapie, in sehr wenigen Fällen auf eine medikamentöse Behandlung hingewiesen. In Bezug auf die mentale Gesundheit sind Prävention, Aufklärung, Akzeptanz und Austausch die häufigsten Ansätze zur Behandlung.
Der Begriff der mentalen Gesundheit bleibt dabei sehr flexibel und scheint damit in diesem komplexen Feld geeignet. Er beschreibt kein konkretes Krankheitsbild, wird sowohl im Zusammenhang mit klar definierten psychischen Erkrankungen genutzt, aber auch im Rahmen von unwissenschaftlichen Beratungsangeboten und Life Coachings für einen gesünderen Lebensstil, eine Lebenseinstellung.
Bezug zur Theorie
Hartmut Rosa argumentiert, dass die Beschleunigungstendenzen basierend auf dem hier vorherrschenden Wirtschaftssystem und dessen Anspruch an ein stetiges Wachstum begründet seien.12 Er macht dafür vor allem die politischen Strukturen verantwortlich.13
Deutlich werden dabei die Regulierungsmechanismen im Rahmen von Foucaults Gouvernementalitätbegriffes. Politische Akteure bestimmen durch ihre Entscheidungsgewalt die gesellschaftlichen Bedingungen maßgeblich mit. Sie haben zum Beispiel Einfluss auf die Studienstruktur, deren Umgestaltung auch die Selbstregulierungsstrategien des Subjektes verändern. Das Subjekt steht zum Beispiel in Laura Arndts Forschung im Fokus.
Hinzu kommt der Einfluss von Ärzten, Krankenkassen und Gesundheitsorganisationen als Institutionen, aber auch der prominenten Menschen, Journalisten sowie Einzelpersonen, deren gestiegene Reichweite als Ergebnis der Digitalisierung gesehen wird. Auch sie scheinen den Diskurs über die mentale Gesundheit entscheidend mitzubestimmen und damit Einfluss auf die Wahrnehmung dieses Themenkomplexes zu haben. Gleichzeitig besagt Foucault Gouvernementalitäts-Theorie auch, dass diese ausgeübte Macht der Regierung und Institutionen von der Gesellschaft legitimiert werde. Die aktuelle Haltung der Gesellschaft im Diskurs scheint insgesamt aber gegen den Leistungsdruck, Stress und die einst von Foucault analysierte Richtung nach der Industrialisierung zu gehen. Das „Unnormale“, das „Ungewöhnliche“, das Abweichen von der Norm scheint allgemein verständlicher zu sein, im Rahmen mentaler Gesundheit auch positiv bewertet. Das Zugeben von Schwächen und Grenzen scheint möglicher. Hier kann die Hypothese aufgestellt werden, dass die Auseinandersetzung mit der eigenen mentalen Gesundheit in den heutigen Strukturen wieder einen Platz hat. Was dabei aber erstaunlich bleibt ist, dass das Leiden am vermeintlich objektiven Leistungsdruck individualisiert wird und die gesellschaftliche Bereitschaft, sich dagegen aufzulehnen, relativ gering erscheint. Eventuell manifestiert sich an dieser Stelle die Legitimation von Regierungsmacht.
Und jetzt?
Im Zuge der hier besprochenen Behandlungsmöglichkeiten ergibt sich der Anschein, dass das Individuum für seine mentale Gesundheit selbst verantwortlich sei und diese individuell behandelt werden müsse. Der Fokus im gesellschaftlichen Diskurs scheint dagegen auf der Wahrnehmung von Krankheit und Gesundheit zu liegen, darauf, Vorurteile auszuräumen und eine umfassendere Inklusion zu erzielen und Akzeptanz zu schaffen.
Im Rahmen der Theorie scheint sich die Problematik, also die Ursache, jedoch auf der Ebene machtausübender Institutionen und ihren Regulierungsmaßnahmen zu befinden, die durch die Gesellschaft legitimiert werden.
Die Komplexität der verschiedenen Einflüsse auf mentale Gesundheit lassen einen allgemeingültigen, allumfassenden Lösungsansatz unmöglich erscheinen. Vorboten eines Wertewandels lassen sich im Diskurs durchaus erkennen, wie sich dieser aber weiter entwickeln wird bleibt fraglich. Fest steht: wir alle haben Einfluss.
„[…] gegen die Auswüchse des Bachelor-Master-Systems kann man ja nur politisch was machen, Teile des Astas werfen uns jetzt zum Beispiel vor, dann reine Anpassungs-Leistung zu machen, wir würden die Leute anpassen, an dieses System. Der Vorwurf geht […] an mir vorbei, weil ich denke, wenn ich Zahnschmerzen habe geh ich zum Zahnarzt unabhängig von Ernährung und Zucker in Lebensmitteln […] das sind zwei verschiedenen Themen. Und natürlich versuchen wir hier Anpassung in dem Sinne zu betreiben, dass diejenigen in dem System nicht untergehen. Davon hat doch keiner was. […] das ist dann nicht unser Bier, Leute zu politisieren. Das wäre mir natürlich am liebsten, individuell helfen und dann wehrt man sich gemeinsam gegen gesellschaftliche Missstände […]“.14
„Ambivalenzbewältigung wird also eine neue Schule der sozialen Ethik erfordern. Man sollte schon jetzt die Lehrpläne erweitern und die besten Pädagogen suchen, sonst brauchen wir in Kürze ein Heer von Therapeuten.“ 15
Eine Forschungsarbeit von Nina Sablotny