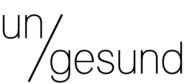a
Agency
Die Fähigkeit und Voraussetzung eines Individuums wirksam zu Handeln.
Ätiologie
Die Lehre über Ursachen und das Entstehen von Krankheiten.
Akustischer Kommunikationsraum
Ein Raum, der durch die akustische Wahrnehmung entsteht.1
b
Beschleunigungstendenzen
Hartmut Rosa beschreibt mit Beschleunigungstendenzen die zeitverändernden Auswirkungen der globalisierten und digitalisierten Welt.2
c
Cis
Cis Personen identifizieren sich vollständig mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht.
d
dichotomie
Dichotomie bezeichnet eine Struktur aus zwei Teilen, die einander gegenüberstehen und einander ergänzen.3
e
Evidenzbasierte Medizin
Eine jüngere Entwicklung der Medizin, die Behandlungen von Patienten auf Basis empirischer Daten (= Evidenz) in Form von klinischen Studien voraussetzt.4
g
Genogramm
Bildliche Darstellung verwandtschaftlicher Zusammenhänge, Beziehungen und Konstellationen
Gesundheitsverhalten (health behavior)
Der Begriff des Gesundheitsverhaltens ist nicht einheitlich definiert. Nach dem amerikanischen Medizinsoziologen Koos umfasst das Gesundheitsverhalten sämtliche Verhaltensweisen und Praktiken von Individuen und Gruppen, die in Bezug zu Gesundheit und Krankheit stehen. Dazu zählt beispielsweise die jeweilige Ernährung, das Suchtverhalten oder Arztbesuche.5
Gutachten
Die Untersuchung und begründete Beurteilung eines Sachverhalts durch einen Sachverständigen. Beispielsweise kann ein Sachverständigengutachten zur Bewertung von Schimmelpilzschäden in Wohnungen durchgeführt werden.6
Gesundheitsprävention
Präventionspraktiken richten sich gegen einen antizipierten Schaden, der vorsorglich verhindert werden soll. Im Falle von Gesundheitsprävention oder auch Gesundheitsvorsorge bezieht sich dieses Verhalten auf den Erhalt von Gesundheit bzw. die Verhinderung von Krankheit.7
Gesundheitswahn
engl. healthism. Eine Medikalisierung des Alltäglichem mit dem Ziel der Gesundheitsförderung und Gesundheitserhaltung (s. auch Gesundheitsprävention).8
h
Habitus
Nach dem Soziologen Pierre Bourdieu ist der Habitus das Auftreten einer Person in Form seines Lebensstils, Sprache, Kleidung und Geschmack. Je nach Rang oder Status in der Gesellschaft können verschiedenen Kapitalstorten ausgeprägt sein: kulturell, sozial, symbolisch und ökonomisch, die das Handeln des Individuums steuern und verinnerlicht werden.9
Heterotopie
Nach Michel Foucault stellt eine Heterotopie einen geschlossenen (urbanen) Raum dar, der sich durch eigene Regeln, Kontrollinstanzen und Mechanismen der Machtausübung kennzeichnet. Außerdem steuern Einschließungs- und Ausschließungsrituale den Zugang zu diesen Räumen (Beispiele: Psychiatrie, Gefängnisse, Bordelle, Museen, Friedhöfe u.a.).10
Hartmut Rosa
Hartmut Rosa ist Professor am Institut für Soziologie der Universität Jena. Seine Schwerpunkte sind Zeitsoziologie und Beschleunigungstheorie, Soziologie der Weltbeziehung, sowie Moderneanalysen und Subjekt- und Identitätstheorien.11
i
Individualisierung
Unter dem Begriff wird ein Prozess der Ablösung traditioneller Lebensformen, in Folge von gesellschaftlichem und sozialen Wandel, verstanden. Tradierte Identitäten und Lebensweisen werden von individuell ausdifferenzierten Lebensformen abgelöst.12
Integration, allg.
Unter Integration wird – ganz allgemein – der Zusammenhalt von Teilen in einem „systemischen“ Ganzen verstanden, gleichgültig zunächst worauf dieser Zusammenhalt beruht. Die Teile müssen ein nicht wegzudenkender, ein, wie man auch sagen könnte, „integraler“ Bestandteil des Ganzen sein. Durch diesen Zusammenhalt der Teile grenzt sich das System dann auch von einer bestimmten „Umgebung“ ab und wird in dieser Umgebung als „System“ identifizierbar.13
Institutioneller Rassismus (auch struktureller Rassismus)
Wenn eine Institution Menschen aufgrund von äußerlichen Merkmalen, ihrem kulturellen Hintergrund oder ihrer tatsächlichen oder angenommenen ethnischen Herkunft diskriminiert oder rassistisch behandelt, dann spricht man von institutionellem Rassismus. Diese Rassismen gehen von einer internen Logik aus, die unabhängig davon ist, inwiefern Akteure innerhalb der Institutionen absichtsvoll handeln oder nicht.14
Intervention
Maßnahme, um gesundheitlichen Krankheiten vorzubeugen, sie zu beheben oder deren Folgen zu behandeln.15
m
Menschen mit Migrationshintergrund
sind nach statistischer Definition in Deutschland lebende Ausländer, eingebürgerte Deutsche, die nach 1949 in die Bundesrepublik eingewandert sind, sowie in Deutschland geborene Kinder mit deutschem Pass, bei denen sich der Migrationshintergrund von mindestens einem Elternteil ableitet.16
Milieu
Aus der soziologischen Perspektive ist das Milieu die Gesamtheit von natürlichen und sozialen Faktoren beim sozialen Handeln und dem Gestalten der Umwelt. Die Akteursgruppen haben gemeinsame Wertehaltungen, Mentalitäten und Wir-Vorstellungen. Milieus sind nicht statisch, sondern abhängig von demografischen, ökonomischen und ökologischen Faktoren.17,18, 19
n
Neoliberales Subjekt
Der in neoliberalen Regierungsformen lebende Bürger, welcher dazu angehalten ist mündig, rational und kalkuliert zu entscheiden und somit so zu handeln, dass das eigene Leid minimiert bzw. das Wohlergehen gesteigert wird.20
p
Pathologisierung
Handlungen, Empfindungen, Zustände und Situationen als krankhaft wahrnehmen und definieren
Prekarität
Die soziologische Definition versteht Prekarität als Unsicherheit in der Erwerbstätigkeit des Einzelnen, schwierigen Lebens- und Arbeitsverhältnissen sowie dem sozialen Abstieg.
PoC
PoC, ausgeschrieben Person of Color oder People of Color, ist eine selbst gewählte Bezeichnung von Menschen, die sich als nicht-weiß definieren. PoC verbinden gemeinsame geteilte Rassismuserfahrungen und Exklusion von der Mehrheitsgesellschaft.
Primärversorgung Der Begriff bezeichnet die medizinische Grundversorgung und Erstberatung der Patient*innen. Im deutschen Gesundheitswesen übernehmen Hausärzt*innen diese Aufgabe.21
r
Roma
ist eine Selbstbeschreibung und der Oberbegriff für eine heterogene Gruppe von Menschen, die vor über 1.000 Jahren, vermutlich aus Indien, nach Europa ausgewandert ist.22
s
Sinti
ist die Bezeichnung für Nachfahren der Romagruppen, die bereits seit dem 15. Jahrhundert in den deutschsprachigen Raum eingewandert sind.23
Soziale Differenzierung
Mit dem Begriff wird das Phänomen der Heterogenität, Vielfalt und Komplexität moderner Gesellschaften bezeichnet, die sich bspw. in differenzierten sozialen Rollen und Positionen, Interessen und Lebensentwürfen zeigt.24
Stigmatisierung
Ein gesellschaftlicher Prozess, indem bestimme Individuen oder Personengruppen, aufgrund bestimmter Merkmale, negativ bewertet werden.
Soziale Determinanten
Damit sind Bedingungen bzw. soziale Verhältnisse gemeint, die durch die Verteilung von ökonomischen und sozialen Ressourcen beeinflusst werden.25
Suizidalität
Die Neigung zum Suizid und umschließt nicht nur den vollendeten Suizid, sondern auch die Absicht und den Versuch eines Suizids.
t
Technogene Nähe Nähe, die indirekt durch die Nutzung von Technik hergestellt wird.26
u
Überwachung und Strafen
Anhand historischer Quellen stellt Michel Foucault in seinem Werk „Überwachen und Strafen“ die Disziplinarmacht und Technologien der Ausübung vor. Das Individuum der Disziplinargesellschaft wird durch die Technologien unterworfen. Es entstehen kontrollierte, dressierte, geübte, fügsame und gelehrige Körper.27
w
Werther-Effekt
Der Begriff des Werther-Effektes entstand aus dem literarischen Werk zur Behandlung von Suiziden im Jahre 1774, „Die Leiden des jungen Werther“ von Johann Wolfgang von Goethe, dessen Publikation eine nachweislich hohe Anzahl von Nachahmungssuiziden bedingte.
White Privilege
Mit „White Privilege“ sind unverdiente Vorteile und Chancen gemeint, zu denen Weiße Individuen aufgrund ihres Weißseins Zugang haben, aber für POC unzugänglich bleiben.