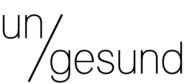Einleitung
Alle 56 Minuten nimmt sich durchschnittlich ein Individuum in Deutschland das Leben. Schätzungen zufolge, versucht es alle sechs Minuten jemand.1 Im Jahr 2015 nahmen sich in Hamburg 208 Menschen das Leben, laut dem statistischen Bundesamt.2 Hamburg präsentiert sich, als ein Bundesland mit einer vergleichsweise niedrig ausfallenden Suizidrate im Verhältnis zu den anderen Bundesländern. In Deutschland nahmen sich 2015 insgesamt rund 10000 Menschen das Leben. Zusammengefasst sind mehr Menschen durch einen Suizid gestorben als durch Verkehrsunfälle, Mord, Gewaltverbrechen, Drogen und Aids.3 Abgesehen von der Dunkelziffer an Suiziden, die laut dem internationalen medizinischen Klassifikationssystem ICD-10 nicht erfasst worden sind.
Diese Forschungsarbeit befasst sich mit dem gesellschaftlichen Umgang von Suizidalität, anhand subjektiver Wertungen und Wahrnehmungen. Das Phänomen des Suizids stellt weitgehend ein tabuisiertes Problemfeld der westlichen Gesellschaft dar. Die hohen Suizidraten fordern einer neutrale Wertung der Thematik und einen öffentlichen Diskurs, um eine Enttabuisierung, wie in den führenden Diskursen um Alterssuizide und Sterbehilfe.4 Suizide sind negativ konnotiert, sie assoziieren Ohnmachtsgefühle, Schwäche und Verzweiflung einer suizidalen Person. Wiederum generieren Suizide den Schmerz und das Leid der Angehörigen und werden als eine irrationale und pathologische Handlung determiniert.5
Die Suizidforschung
Die Suizidologie, als eigene interdisziplinäre orientierte Suizidforschung, entstand in den 60er Jahren. Forschungen zu Suizidalität etablierten sich bereits im 19. Jahrhundert in den Human-und Sozialwissenschaften, insbesondere in der Psychiatrie, Psychologie, Biologie, Recht, Philosophie, Anthropologie und Soziologie.6 Der Kulturwissenschaftler Thomas Macho verweist in seinem Werk „Das Leben Nehmen“ auf eine radikale Umwertung des Suizids, seit dem Ende des zweiten Weltkrieges.7 Macho bezieht sich einerseits auf den Prozess der Enttabuisierung, anderseits auf das Aufkommen emanzipatorischer „Selbsttechniken“ in diversen kulturellen Feldern: als subversives Element des Protestes, des Anschlags, Attentates, des bewaffneten Konfliktes, als essentiel für die Philosophie, Künste, Literatur und Film.8 Wiederrum konstatiert sich Suizidalität in der Postmoderne weiterhin als ein weitgehend tabuisiertes Problemfeld, welches einer soziokulturellen Aufklärung bedarf. Das Klassifizieren von suizidalem Verhalten als eine mentale Störung weist auf einen bestehenden monopolistischen psychiatrischen Ansatz und eine manifestierten Pathologisierung, wie Stigmatisierung hin.9 Heidi Hjelmeland, norwegische Professorin für den Bereich mentale Gesundheit, appelliert in dem Sammelband „Suicide and Culture: Understanding the Context“ auf eine biologische Wende innerhalb der Suizidologie und Suizidprävention und auf die Integration kultureller Faktoren für die Forschung.10 Die Klassifikationen der Psychiatrie wie der Verhaltenswissenschaften bewegen sich demnach überwiegend innerhalb der biologischen Disziplin, zentriert auf eine rein biologische und genetische Erklärung menschlichen Verhaltens. 11 Ein Grund für die Fokussierung auf biologische Faktoren ist, dass den traditionellen Naturwissenschaften meist eine höhere Stellung und Legitimität beigemessen wird, abgesehen vom ökonomischen Interesse einer entsprechenden Medikation klassifizierter Patienten*innen.12 Der französische Psychiater Esquirol klassifizierte 1838 als erster Suizidalität als eine Form der Geisteskrankheit. Als bestimmend für die Umwertung des Suizids in der Moderne, deutet Macho das Aufkommen der Medizin, Psychiatrie und Psychologie, die zu einer Legitimation des Suizids beitrugen, im Sinne der Pathologisierung.13 Die westliche Institutionalisierung der Suizidprävention entstand zeitgleich mit dem Aufkommen der Suizidologie. Als Erstbegründer der institutionellen Suizidprävention, positioniert sich der Individualpsychologe Erwin Ringel, 1948 in Wien mit der damals bezeichneten „Lebendsmüdenfürsorge“.14 Weitere nennenswerte Institutionen des globalen westens, sind die International Association of Suicide (IASP), die American Association of Suicidology (AAS) und die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention (DGS).15 Befürworter*innen eines Einbezugs des soziokulturellen Kontextes innerhalb der Entwicklung, Behandlung und Prävention von suizidalen Verhalten, sind meist auch Verfechter*innen der Präventions- und Interventionswissenschaft. Suizidprävention impliziere das Leben, als einen Wert an sich und lässt somit soziale Missstände als peripher erscheinen.16
Theorie
Suizidalität als soziales Phänomen
Wegbereiter für eine Integration und Umwertung des Suizids innerhalb der Geisteswissenschaften war der französische Soziologe und Ethnologe Émil Durkheim mit seinem Werk Le Suicide von 1897.17 Durkheim verstand den Suizid als ein soziales Phänomen, welches nicht ausschließlich durch organisch- physische Faktoren zu erklären sei.18 Hierzu verwies er auf die Abhängigkeit sozialer Ursachen (die Kohärenz des Individuums von der Gesellschaft), zur Erklärung der damaligen hohen Suizidrate anhand einer deduktiven Analyse.19 Dabei stützte er sich auf die Grundannahme, dass der Suizid quantitativ und qualitativ direkt vom Verhältnis des Individuums zur Gesellschaft ermessbar sei.20 Durkheim klassifizierte dazu vier Grundtypen des „Selbstmordes“ und unterteilte diese in eine Abhängigkeit der Integration eines Individuums zur Gesellschaft und in Abhängigkeit der gesellschaftlichen Regulation eines Individuums. Demnach sich das Individuum in einem gesellschaftlichen Zustand der Regellosigkeit oder der Überreglementierung, durch institutionelle Kontrollsysteme befindet.21 Grundsätzlich gilt es diese Klassifikationen als obsolet und kritisch zu betrachten, um ihrer geltenden Eigenschaft einer weiteren Klassifikation von suizidalem Verhalten. So wird hier vor allem auf einen wegbereitenden Ansatz der Suizidforschung in einer Disziplin der Geisteswissenschaften verwiesen.
Gesellschaftliche Macht und Subjektivierung
„Die Gesellschaft ist jedoch nicht nur ein Gegenstand, der mehr oder weniger stark Denken und Handeln der Individuen beansprucht. Sie ist auch eine Macht, die sie bestimmt. Zwischen der Art und Weise, wie sie diese Funktionen ausübt, und der sozialen Selbstmordrate besteht ein Zusammenhang.“ (Durkheim 1897, S. 273).
Auch der französische Philosoph des Poststrukturalismus, Foucault erklärt den Begriff der „Macht“ an gesellschaftlichen Praktiken, in denen das menschliche Subjekt innerhalb der Produktions- und Sinnverhältnisse steht und beeinflusst wird.22 Macht besteht nicht nur in der Theorie, sondern ist Teil unserer Erfahrungswelt und Subjektivierung. Hierzu verweist Foucault auf die Auswirkungen bestimmter Machtpositionen, die auf das Individuum einwirken und dieses in seiner Individualität und Identität bestimmbar macht. Im Feld einer pathologischen, klassifizierten Suizidalität, ist es die Medizin und die Psychiatrie, deren kontrollierende Macht sich auf den Körper, die Gesundheit, Leben und Tod des Individuums ausübt.23 Diese Machtform ist spürbar und Teil unseres Alltagslebens sie bedingt die Einteilung in Kategorien und formt die Individuen zu kontrollierbaren Subjekten.24
Forschungsdesign
Eine der Methoden, die zur qualitativen Analyse herangezogen wurden, ist die Mediendiskursanalyse. Hierzu wurden Medien in Form von Artikeln und Sendungen des öffentlich rechtlichen Rundfunks und Radiosendungen ausgewertet, die sich explizit im Diskurs, um die Tabuisierung von Suizidalität konstituieren. Als weitere Methode diente das qualitative Interview. Anhand eines Leitfragebogens wurden zwei Personen, um ihre subjektive Wertung und Assoziation von Suizidalität befragt, wie um ihre eigene Erklärung, warum ein Mensch sich das Leben nimmt und ihre Wertung der Substantive, die es im deutschsprachigen Raum zur Umschreibung zur Verfügung stehen. Ob bewusst oder unbewusst, erfolgt bei der jeweiligen Begriffswahl zur Umschreibung schon eine Wertung und jeweilige Konnotation. Das Zusammenwirken des Suizids mit sozialen, ethnischen, religiösen wie auch politischen und wirtschaftlichen Zeitumständen, impliziert die Verwendung einer angemessenen Terminologie, zur Beschreibung des suizidalen Aktes: Selbstmord, Freitod, Suizid? 25
Ergebnisse
Mediendiskursanalyse
Zunächst wird nach Foucault erläutert, weshalb sich Suizidalität im öffentlichen Diskurs als ein Tabuthema repräsentiert. Foucault klassifizierte drei fundamentale Ausschlusskriterien, die in einer Gesellschaft den Diskurs regulieren.26 Im Raum des Möglichen, in dem über Suizide gesprochen werden kann, wird der Diskurs durch das Tabu und die Vorschriften reglementiert. Dies ist bedingt durch die lange Tradition eines gesellschaftlichen Verbotes. Die über Jahrhunderte langanhaltende Interpretation eines Suizids als eine schwere Sünde und Verbrechen,27 entwickelte sich aus einer prägenden christlichen Tradition.28 Die stigmatisierende Behandlung der Leiche, wie die Verweigerung eines christlichen Begräbnis und die Enteignung des Familienvermögens, implizierte eine Abwertung der sozialen Stellung der Angehörigen.29 Erst seit 1983 sind katholische Priester dazu verpflichtet, Suizidanten*innen nach dem christlichen Ritual zu beerdigen.30 Strafrechtlich verfolgt wurde der Suizid bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, in Großbritannien bis 1961, in Israel bis 1966.31 Als zweites Regulierungsinstrument führt Foucault die Gegenüberstellung des Vernünftigen und Unvernünftigen auf, dem Ausschluss des „Wahnsinnigen“ vom Diskurs. Suizidale Personen werden vom Diskurs ausgeschlossen, da sie nicht der gesellschaftlichen Norm des „Vernünftigen“ entsprechen. Akteure, welche sich im Diskurs auf die individuelle suizidale Erfahrung beziehen, reflektieren diese als eine „unvernünftige“ vergangene Handlung. Als dritte Regulierung weist Foucault auf die Unterscheidung von wahr und falsch hin. Im gegenwärtigen Diskurs um die Tabuisierung von Suizidalität wird immer wieder der Wahrheitsgehalt bestimmter Aussagen reproduziert, zum Beispiel ob eine suizidale Handlung als ein Akt der bewussten Selbstbestimmung interpretiert werden kann, welche Terminologie als angemessen erscheint und, ob sich alle Suizide auf eine psychische Erkrankung zurückführen lassen.
Akteure der Psychiatrie und Psychologie im Kontext der Suizidprävention dementieren den Begriff des „Freitods“, da er suggeriere, dass eine suizidale Person aus freien Stücken handeln würde.32
Ebenso wird die Bezeichnung des „Selbstmordes“ abgelehnt im Bezug auf den juristischen Begriff „Mord“, der eine Planung und einen Vorsatz voraussetzt. Nach der Vorsitzenden der „Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention“ verschränkt sich das gesellschaftliche Tabu in der Annahme das Leben an sich stelle das höchste Gut eines Menschen dar. Eine suizidale Person, stelle sich gegen das höchst interpretierte Gut und bricht durch diese Handlung das Tabu.33
„Man hat auch noch Sorge, über den Suizid zu reden, weil das Gerücht einem im Hinterkopf Beschwerden verursacht, dass der Suizid oder dass der Diskurs über den Suizid auch Nachahmungssuizide zur Folge haben kann.“ (Macho, Dlf Kultur 20.02.17).
Im Hinblick auf das gesellschaftliche Bewusstsein, welches durch die mediale Berichtersttagung beeinflusst wird, wird der Enttabuisierung das Phänomen des „Werther- Effektes“ gegenübergestellt. Aus Angst vor Nachahmungssuiziden gebietet der Pressecodex des Deutschen Presserates Zurückhaltung in der Berichterstattung über die Selbsttötung, im besonderen für die Nennung von Namen, die Veröffentlichung von Fotos und die Schilderung näherer Begleitumstände.34
Akteure, die ihren versuchten Suizid überlebten, fordern im Diskurs explizit eine sofortige Enttabuisierung. Sie stellen das Tabu und die gesellschaftliche Stigmatisierung in den Fokus ihrer aufklärerischen Arbeit, um anderen suizidalen Personen zu helfen. Zudem betonen die Akteure aus ihrer subjektiven Erfahrung heraus, wie wichtig es für eine suizidale Person ist, ungehemmt über die eigenen suizidalen Absichten reden zu können. Hierzu wird auf den Akteur S. L. verwiesen, der in Kooperation mit dem Stigma e.V. das Projekt NoSE (no suicidal exit) errichtete:
„Ziel des Projektes ist es, das Tabutthema Suizid durch Bild- und Filmbeiträge in den öffentlichen Wahrnehmungsraum zu (be-)fördern und ein aufgeklärtes Bewusstsein zu schaffen.“ 35
Angehörige von Suizidanten*innen fordern im Diskus überwiegend einen Bruch des Schweigens und mehr Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft. Oftmals werden Suizide innerhalb der Familie verdrängt und als ein Tabu gepflegt, aufgrund von Scham und Angst vor Nachahmung.
Die meisten Medien, die zur Analyse herangezogen wurden, verwiesen im Anschluss auf den Kontakt der telefonischen Seelsorge.
Subjektive Wertung von Suizidalität
Von beiden befragten Personen werden wiederholende Suizidversuche einer nahestehenden Person beschrieben. Beide Befragten legitimieren die suizidale Handlung durch einen Verweis auf eine psychische Erkrankung der bekannten Personen. Als Beweggrund werden schwere Depressionen und schmerzhafter Liebeskummer mit anschließendem Aufenthalt in der Psychiatrie genannt.
Der ersten befragten Person, Diplom-Soziologe (30 J.), fällt eine direkte subjektive Assoziation von Suizidalität nicht leicht und er assoziiert Suizidalität als etwas, dass „auftaucht“ und meist in Verbindung mit einer psychischen Erkrankung steht. Die Person stellt die Tendenz der Pathologisierung gegenüber der Verachtung und Tabuisierung, die für ihn mit der Thematik um Suizidalität einhergeht. Die interviewte Person begründet die einhergehende Tabuisierung von Suizidalität mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Einer Disziplinierung der Gesellschaft durch das „einreden sich nicht umbringen dürfen“. Daraus resultiert für die befragte Person die gesellschaftliche Gehorsamkeit und das zur Verfügung stehen als produktive Arbeitskraft. Hierzu wird auf Foucaults Begriff der Biomacht verwiesen, auf die Diziplinar – und Sicherheitstechnologie.
Des Weiteren geht die Person auf die Wechselbeziehung einer extrinsischen Motivation : „Umfeld aufgeben“ und „den Rest mit auslöschen“ und einer intrinsischen Motivation: „sich selbst aufgeben und sich selbst auslöschen“, ein. Im Bezug auf Durkheim lässt sich hier auf das Abhängigkeitsverhältnis eines Individuums von der Gesellschaft schließen.
Die zweite befragte Person, Pflegekraft (60 J.), assoziiert direkt:
„Ja, ein selbstschädigendes Verhalten verbunden mit starken emotionalen Störungen.“
Diese Aussage steht im direkten Zusammenhang mit einer mentalen „Ungesundheit“.
Hinzu verweist die Person auf die anthropologische Konstante, die Suizide seit jeher abbilden:
„Ja, das ist halt, dass es das schon immer gab, denke ich, dass die Menschen sich schon immer aufgrund von traumatischen Erlebnissen oder Verzweiflung sich umgebracht haben. Dass es wahrscheinlich zum Mensch sein gehört, irgendwo“.
Beide befragten Personen erklären sich suizidale Handlungen und suizidales Verhalten mit einem Gefühl der Ohnmacht, Hilfslosigkeit und Verzweiflung einer suizidalen Person.
Subjektive Wertung der Begrifflichkeiten
Selbstmord
„Wer von „Selbstmord“ spricht , stellt sich damit in eine durch das christliche Suizidverbot geprägte Tradition, die das Verfügungsrecht über das eigene Leben prinzipiell ablehnt.“ (Baumann 2001, S.4.).
Den meisten Personen, die den Begriff des „Selbstmordes“ gebrauchen, ist die religiös-moralische Konnotation nicht bewusst, welche sich ab dem 17. Jahrhundert etablierte.36 Im umgangssprachlichen Sprachgebrauch wird diesem Begriff sogar eine gewisse Neutralität zugeschrieben. Die zweite interviewte Person (60 J.) wertet den Begriff des „Selbstmordes“ als neutral und alltagstauglich. Die erste befragte Person wertet den Begriff als problematisch und ist sich der religiösen Konnotation bewusst. Auch möchte sich die befragte Person vom „Mord“ im „Selbstmord“ distanzieren. Die Person bevorzugt die Beschreibung der Suizidhandlung, „sich umbringen“. Trotz Distanzierung der befragten Person von den Begrifflichkeiten „Selbstmord, Freitod und Suizid : “…,weil mir diese Nomen irgendwie alle so ein bisschen suspekt sind,…“, gebraucht die Person zweimal unbewusst im Verlauf des Interviews den Begriff „Selbstmord“ innerhalb der Erzählung.
Freitod
„Durch seinen Freitod entzieht sich ein Mensch der Gesellschaft und trotzt ihren Tabus“ (Mischler 2000, S.15).
Der heroische Begriff des „Freitods“ führt auf Nietzsche zurück und impliziert eine positive Konnotation und Legitimation des suizidalen Aktes.37 Jean Améry beschreibt in seinem Werk „Diskurs über den Freitod“ den freien Tod als eine hochindividuelle Angelegenheit, die niemals ohne gesellschaftliche Bezüge umgesetzt wird, mit der das Individuum mit sich allein ist, aber nie frei von Sozietät.38 Beide befragten Personen werten den Begriff des „Freitods“ als zu beschönigend und nicht alltagstauglich.
Suizid
Der „Suizid“, als ein medizinischer Fachbegriff, wird seit Mitte des 19. Jahrhunderts verwendet.39 Die Etymologie des „Suizids“ stammt aus dem lateinischen, wobei „sui“ sich von „seiner“, „selbst“ und „caedere“ „töten“ ableitet und sich als „Selbsttötung“ übersetzen lässt. Dabei umschließt der Begriff das absichtliche Beenden des eigenen Lebens durch Selbstverletzung. Dies kann in aktiver oder passiver Form geschehen.40
Beide befragten Personen distanzieren sich vom Begriff des Suizids, werten diesen als medizinisch-psychologisch und technisch. Einer der Befragten empfindet den Begriff als deutend und keinesfalls wertfrei. Der „Suizid“ ist weiterhin ein Fachterminus der Wissenschaft und wird im Alltag nur wenig verwendet.
Fazit & Ausblick
Die Integration kultureller Faktoren in der Suizidforschung und Suizidprävention ist für die Erfassung der individuellen Lebenswelt einer suizidalen Person, in Relation zu seiner gesellschaftlichen Disposition, unvermeidlich. Suizidalität repräsentiert sich als ein komplexes multifaktorielles Phänomen, welches durch die Konstruktion eines gesellschaftlichen Tabus im Diskurs reglementiert wird. Um bestehende gesellschaftliche Machtverhältnisse zu analysieren, gilt es die Praktiken im Feld der Unvernunft zu erforschen. Ein gesellschaftlicher Bruch des Schweigens um suizidale Handlungen erfordert eine weitgehende Enttabuisierung, Entmoralisierung wie Entpathologisierung der Thematik, der Gesellschaft und des Einzelnen. Die Sensibilität der Thematik impliziert einen angemessenen Sprachgebrauch, so müssen gegebene Begrifflichkeiten um ihre historische Entstehung und Bedeutung kritisch hinterfragt und kontextualisiert werden. Die Art und Wiese, wie wir suizidale Handlungen werten und darüber sprechen, wirkt sich auf unseren Umgang mit suizidalen Individuen in der Gesellschaft aus.